Der Journalist und Autor Björn Stephan schreibt regelmäßig für die ZEIT und gelegentlich für das SZ-Magazin. Seine Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Axel-Springer-Preis, dem Deutschen Sozialpreis und dem Reporterpreis. Mit „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ ist nun sein Romandebüt erschienen. Ein Buch, von dem Bestsellerautor Benedict Wells sagt: „Mit viel Einfühlungsvermögen, Witz und Melancholie erzählt Björn Stephan in seinem Debüt von der ersten Liebe und dem Aufwachsen in den Ruinen eines verschwundenen Landes. Der Held sucht nach besonderen Worten, sein Autor hat sie immer wieder gefunden.“ Das klingt fast schon nach einem Ritterschlag. Wir haben mit dem 1987 geborenen Schriftsteller, der in Schwerin aufgewachsen ist, über einzigartige Wörter und schlaue Sätze, über das Suchen und Finden von Romanfiguren und deren Namen, sowie über Notizhefte mit Ledereinband gesprochen.
Wie bist zu zum Geschichtenerzählen gekommen?
Über den Journalismus. Als Reporter mache ich ja genau das: Ich recherchiere und schreibe die Geschichten von anderen auf. Das mache ich schon eine ganze Weile und auch immer noch gerne. Aber trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, mal etwas anderes schreiben, mich in einer anderen Form ausprobieren zu wollen, die weniger reglementiert ist, bei der ich mehr experimentieren kann. Bei der ich nicht nur ausschließlich das schreibe, was passiert ist, sondern auch das, was passiert sein könnte, was jemand fühlt, denkt, erinnert oder sich vorstellt.
Für welche Geschichten brennst du, beziehungsweise, nach welchen Kriterien suchst du dir die Geschichten aus, über die du schreibst?
Das ist ganz unterschiedlich. Als Reporter schreibe ich über völlig verschiedene Themen, über Missbrauch, über Bildungsungerechtigkeit, über Pferderennen. Am wichtigsten aber ist für mich, dass ich die Geschichten für relevant halte und, dass sie mich berühren, weil sie etwas Neues über die Welt erzählen oder etwas Interessantes über das Leben selbst.

Dein Debütroman „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ handelt „von der Poesie des Plattenbaus, der ersten Liebe, weißen Zwergen und blauen Riesen“. Worum genau geht es in dem Buch?
Es geht um Sascha Labude, einen 13 Jahre alten, etwas verträumten Jungen, der einzigartige Wörter sammelt und in einer Plattenbausiedlung namens Klein Krebslow wohnt, irgendwo in Ostdeutschland. Es geht um seinen besten Freund Sonny, der Klavier spielt und eines Tages so berühmt werden will wie Elton John. Und es geht um Juri, ein Mädchen, das in die Siedlung zieht und alles über das Universum zu wissen scheint, nur wo sie selbst herkommt, das will sie nicht verraten. Es geht um einen Sommer im Jahr 1994, um Herkunft und Erinnerung. Und es geht um ein Wort, das fehlt. Ein Wort, das beschreibt wie es ist, wenn du den Ort, den du am meisten liebst, verlassen musst.
Was wolltest du zum Ausdruck bringen, beziehungsweise gab es von Beginn an ein Leitmotiv?
Schwierige Frage. Manchmal macht man ja einfach und fragt sich erst hinterher, warum das jetzt genau so geworden ist … Aber ein zentraler Gedanke für mich war in jedem Fall, dass nichts so ist, wie es scheint. Und dass die Dinge umso vielschichtiger werden, je näher man ihnen kommt. Dieser Gedanke spiegelt sich ja auch im Titel wider: „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“. Was sich übertragen lässt: Nur vom Westen aus wirkt der Osten grau. Nur von der Stadt gesehen leben in der Siedlung „Assis“, wie die Mutter von Sascha Labude sagen würde.
Wie hast du zur Geschichte und deren Helden Sascha Labude (und den anderen Protagonist*innen) gefunden – oder sie zu dir?
Wahrscheinlich haben wir uns in der Mitte getroffen. Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, mich mit meiner Herkunft und Ostdeutschland auseinanderzusetzen. Und deshalb wusste ich schnell, dass die Geschichte Anfang der 90er Jahre in einer Plattenbausiedlung spielen soll und, dass meine Protagonist*innen jugendlich sind. Das fand ich interessant, diese Gleichzeitigkeit der Umbrüche: Einmal die Umbrüche der Pubertät und des Erwachsenwerdens im Leben von Sascha, Sonny und Juri.
Und auf der anderen Seite der politische Umbruch, die Erfahrungen der Nachwendezeit, die sich, wie ich finde, besonders gut an Plattenbausiedlungen erzählen lassen. Wobei das Wort „Platte“ im Roman gar nicht vorkommt, weil man zu DDR-Zeiten von „Neubauten“ gesprochen hat. Das hat sich erst nach dem Mauerfall geändert, als die „Neubauten“ zur „Platte“ wurden und die ehemals heiß begehrten Wohnungen zum Symbol für sozialen Abstieg und Zerfall.
Wie wichtig sind Namen von Romanfiguren? Welche Bedeutung haben sie?
Sehr wichtig, so heißen die Figuren ja! Solange ich keinen richtigen Namen für eine Figur habe, ist sie nicht wirklich lebendig. Ich bin deshalb immer auf der Suche nach Namen, die etwas in mir auslösen. So wie Labude, Kletsche, Reza, da hatte ich gleich Bilder, Gesichter vor Augen. Manchmal, wenn mir ein Name fehlt, streife ich durch die Nachbarschaft und lese mir die Klingelschilder durch. Oder ich durchforste online irgendwelche alten Kader von Fußballmannschaften, bis ich den Richtigen gefunden habe.
Dein Roman spielt an einem Phantasie-Ort namens Klein Krebslow, einer ziemlich öden Plattenbausiedlung in Ostdeutschland. Du selbst bist in Schwerin aufgewachsen und lebst heute in München. Wie sehr hat dich deine Heimat geprägt und was empfindest du heute für diese Region?
Schwerin ist mein Zuhause, da wohnt meine Familie, da kehre ich gerne hin zurück, und deshalb hat mich Schwerin natürlich auch sehr geprägt. Wobei man nicht den Fehler machen und die beiden Orte miteinander verwechseln sollte: Klein Krebslow existiert nur in meinem Kopf und im Buch natürlich. Ich finde, darin liegt ja gerade die Magie von Literatur. Dass man nicht über sich selbst schreibt, sondern eine Geschichte erfindet, die dann wiederum andere lesen und so zu ihrer eigenen machen.

Dein Romanheld Sascha Labude sammelt einzigartige Wörter. „Wie zum Beispiel Ling, ein Wort, das aus China stammt und das Geräusch beschreibt, wenn zwei Jade-Steine aneinanderschlagen.“ Führst du selbst auch eine (geistige) Liste mit Lieblingswörtern?
Nein, das ist nur das Hobby von Sascha Labude. Erst vor Kurzem habe ich allerdings ein großartiges, neues Wort gelernt, nämlich aus dem tollen Roman meines Kollegen Alard von Kittlitz. Und zwar kommt das Wort aus dem Englischen und heißt „to sonder“ und beschreibt, laut Urban Dictionary, „die Erkenntnis, dass jeder zufällige Passant ein ebenso intensives und komplexes Leben führt wie man selbst“. Ich glaube, Sascha Labude hätte sich das Wort sofort notiert.
Apropos Listen: Führst du, so wie Sascha und wie man es von einem „echten Schriftsteller“ erwartet, stets ein in Leder gebundenes Notizheft mit dir spazieren, um Alltagsbeobachtungen und geniale Geistesblitze darin festzuhalten? Oder favorisierst du eher die digitale Notiz-Variante?
Ich besitze Notizhefte, manchmal schreibe ich auch etwas in sie rein. Aber eigentlich schicke ich mir lieber selber Mails vom Handy auf meinen Computer, wo ich sie dann im Posteingang mit einem roten Fähnchen versehe. Das ist wahrscheinlich keine ganz effiziente Methode, weil sich bei mir hunderte Mails mit roten Fähnchen im Posteingang stauen, aber für mich funktioniert sie. Vor allem, weil so nichts verloren geht und ich so außerdem auch keine Probleme habe, meine eigene Schrift zu entziffern.
In deinem Roman tauchen immer wieder Sätze auf, die auf den ersten Blick einfach und auf den zweiten ziemlich genial klingen, etwa: „Das Problem mit schlauen Sätzen ist ja meistens, dass sie gut klingen, aber in Wahrheit nicht stimmen.“ Ist das auch „bloß“ ein schlauer Satz, oder deiner Meinung nach wahr?
Das ist eine lustige Frage. Spontan würde ich sagen, dass dieser Satz eine der seltenen Ausnahmen ist. Er ist halbwegs schlau und könnte sogar stimmen.

In deinem Buch erwähnst du nebenbei auch Romanfiguren wie Huckleberry Finn. Welche Bücher und Helden haben dich durch deine Kindheit begleitet?
Ich habe damals alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Abenteuerromane von Jack London, die Geschichten von Karl May über Winnetou, alles von Erich Kästner. Geliebt habe ich auch „Oliver Twist“ und die Bücher von Liselotte Welskopf-Heinrich über „Die Söhne der großen Bärin“. Oder die Geschichten von Alexander Wolkow über den Zauberer der Smaragdenstadt oder den schlauen Urfin und seine Holzsoldaten. Aber ich glaube, die kennt man vor allem in Ostdeutschland, oder?
Welche Bücher haben dich (ganz unabhängig von der Lebensphase) nachhaltig geprägt?
Das waren und sind ganz unterschiedliche. Was mir sofort einfällt ist „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John Green, weil es mir gezeigt hat, dass man gleichzeitig lustig und todtraurig schreiben kann. „Bestattung eines Hundes“ von Thomas Pletzinger war für mich auch sehr wichtig. Das Buch schafft es einfach so eine ganz bestimmte, feine Stimmung zu transportieren und hat mir auch gezeigt, wie Literatur mit Formen und Tonalitäten spielen kann. Und an der “Neapolitanischen Saga“ von Elena Ferrante fand ich alles großartig! Die Figuren, die so lebendig und vielschichtig sind, dass ich sie nie wieder vergessen werde. Und vor allem kenne ich keinen anderen Roman, der so fantastisch von einer Freundschaft erzählt.
Du hast noch nie zuvor einen Roman verfasst. Wie bist du dieses Projekt angegangen? Was fiel dir (überraschend) leicht, was schwer?
Leichter als gedacht war es, den Ton zu finden, der war plötzlich da. Die Stimme von Sascha Labude. Dann habe ich angefangen, die ersten Seiten zu schreiben und dann kam alles Weitere: Die anderen Figuren, die anderen Stimmen, der Rest der Geschichte. Parallel habe ich sehr viele Gespräche geführt und auch sehr viel gelesen und recherchiert, um die Nachwendezeit treffend zu beschreiben. Meine Figuren sind nämlich ein paar Jahre älter als ich und haben deshalb ja auch ganz andere Erfahrungen und Erinnerungen an diese Zeit als ich sie habe.
Von Thomas Mann ist überliefert, dass er sich täglich von exakt 9 Uhr bis 12 Uhr an seine Texte gesetzt hat und von Hemingway, dass er diszipliniert jeden Morgen geschrieben hat. Er soll gesagt haben, dass die „Schreibroutine der vielleicht wichtigste Erfolgsfaktor“ ist. Hattest du dir während des Schreibprozesses eine feste Routine angewöhnt?
Ja, ich bin ein großer Fan von Routinen. Meine Arbeitstage sind total gleichförmig. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich jeden Tag gegen 11 Uhr angefangen, drei Stunden geschrieben, eine Pause gemacht, dann nochmal zwei Stunden geschrieben, dann bin ich joggen gegangen – schließlich muss man ja auch mal raus. Wenn es gut lief, hatte ich am Ende des Tages zwei, drei neue Seiten beisammen.
Erfahrungsgemäß hält sich quasi niemand an Manuskript-Abgabetermine. Beinahe so, als gäbe es ein ungeschriebenes Gesetz, sich bloß nicht an Deadlines zu halten … Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Deadlines?
Es klingt komisch, aber ich mag Deadlines. So sehr, dass ich meistens sogar ein paar Tage vor Abgabe fertig bin, um den Text noch ein wenig liegen und ruhen lassen zu können. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sonderlich schnell wäre, sondern nur damit, dass ich mir sehr viel Zeit nehme. Ich möchte nämlich unbedingt vermeiden, dass am Ende Hektik aufkommt. Hektik macht mich nämlich extrem nervös.
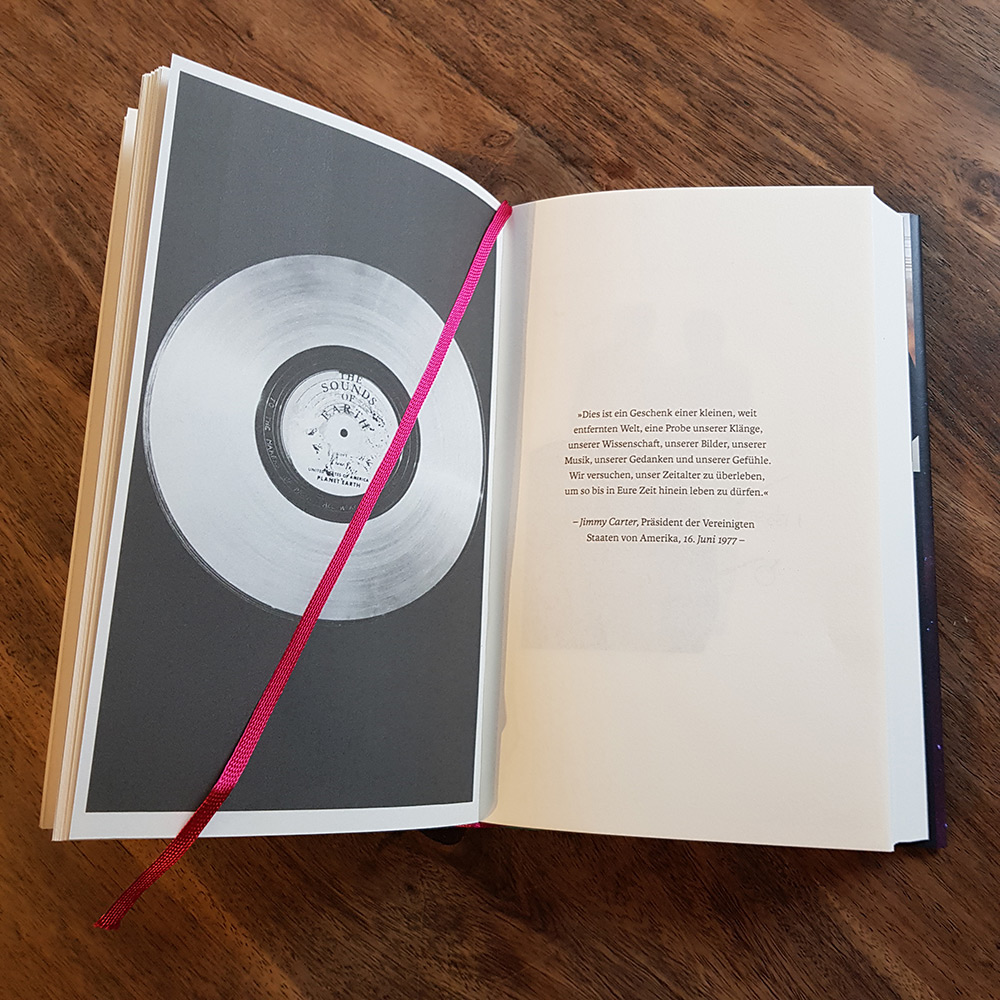
Spukt bereits eine Idee für einen neuen Roman in deinem Kopf herum? Oder bist du froh, dich in kommender Zeit erst mal wieder mit kürzeren Texten, sprich Reportagen zu befassen?
Beides. Ich freue mich aufs Reportagen schreiben, aufs Leute begleiten, mit ihnen rumhängen, vor allem, sobald das wieder einfacher als jetzt möglich sein wird. Ich habe allerdings auch schon zwei, drei lose Ideen für ein neues Buch.
Welche Lektüre liegt aktuell auf deinem Nachttisch?
„Das achte Leben (Für Brilka)“ von Nino Haratischwili. Ein großer, epischer, ganz toller Roman.
Welche Bücher (und/oder auch Podcasts) kannst du unseren Leser*innen abschließend wärmstens empfehlen?
Oh so viele! Die meisten kennen die Leser*innen vermutlich schon. Aber ich empfehle „Flammenwerfer“ von Rachel Kushner, weil sie einfach fantastisch schreiben kann. Ich empfehle auch die „Effingers“ von Gabriele Tergit, die ich erst vor Kurzem entdeckt habe, weil dieses Buch beweist, dass große Literatur problemlos fast ein Jahrhundert überdauern kann. Und ich empfehle „Wie alles kam“ von Paul Maar, weil ich das gerade gelesen habe und es ganz bezaubernd fand.
LESUNGEN:
- März Literaturhaus in Hamburg
- Mai Literaturfestival Wortspiele in München
- März Debüt am See Literaturhaus in Heilbronn
Fotos:
Björn Stephan / Mario Wezel
Interview: Lesley Sevriens

